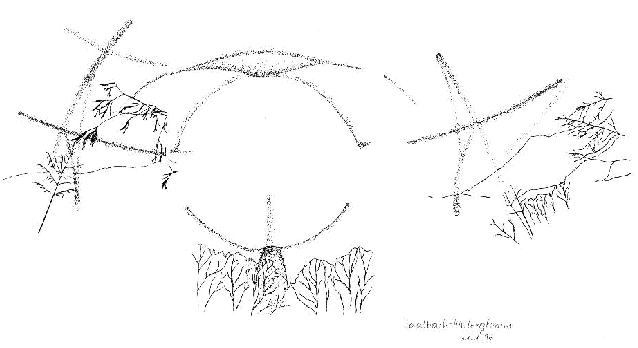
Diese Skizze des Phänomens wurde von Karl Kaiser anhand der Fotos angefertigt.
Vor etwa 20 Jahren hatte ich an einem Seminar über Limnologie an der Uni Salzburg teilgenommen, das von Dr. Werner Mahringer, Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik, gestaltet worden war. Viele male hatte ich mir schon vorgenommen, ihn aufzusuchen. Weihnachten 1996 war es dann endlich soweit, und er nahm sich Zeit, sich mit mir über Meteorologie zu unterhalten. Ich zeigte ihm verschiedene Aufnahmen von NLC's, normalen Wolken, Halos... Am Ende der Unterredung, gleichsam als Höhepunkt, holte Dr. Mahringer ein Kuvert mit Bildern eines Halophänomens, daß eine Salzburgerin in Saalbach-Hinterglemm erleben und fotografieren konnte. Schon bei der ersten oberflächlichen Betrachtung der Aufnahmen entdeckte ich 7 verschiedene Haloformen. Dankenswerterweise gab mir Dr. Mahringer die Adresse von Frau Architekt Dipl.-Ing. Inge Fuhrberg und wenige Tage später hatte ich die kostbaren Negative in der Hand, um Bilder entwickeln zu lassen.
Die von mir angefertigte Skizze enthält die Informationen von 6 Aufnahmen, die sich zum Teil überschneiden. Auffallendste Elemente des Phänomens sind der obere und untere Berührungsbogen, die in gleißendem Licht erstrahlen und scheinbar ins Innere des 22°-Ringes hineinreichen (vergl. MM Nr. 12/97, S. 201: Ungewöhnliche Berührungsbögen) sowie der Horizontalkreis, der in stärkster Intensität durch die Bilder zieht. In reinen Spektralfarben zeigen sich die Infra- und Supralateralbögen, die einander am Horizontalkreis schneiden. Ein vollständiger Parrybogen spannt sich mit großer Helligkeit zwischen linkem und rechtem Schenkel des oberen Berührungsbogens. Recht unscheinbar ausgebildet sind beide Nebensonnen und die untere Lichtsäule; der 46°-Ring ist nur im Bereich des Horizontalkreises schwach zu erkennen. Auf zwei Bildern ist ein Teil vom Wegeners Gegensonnenbogen zu finden, auf einer Aufnahme ein Stück des Untersonnenbogens!
Begeistert zeigte sich Dr. Tränkle von den Bildern und überraschte mit dem Ergebnis seiner Simulation (erstellt mit HALOET): Eine Verstärkung der Farbintensität am linken Schenkel des Supralateralbogens rührt von einem Parrybogen her (Simulation ausschließlich mit Säulen mit doppelter Orientierung/Parryorientierung).
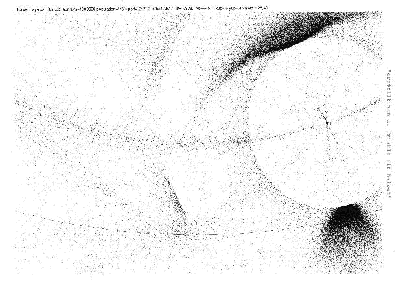
Simulation: Dr. Tränkle
Das Phänomen setzt sich somit aus den folgenden Haloformen zusammen: 22°-Ring mit beiden Nebensonnen, oberer und unterer Berührungsbogen, untere Lichtsäule, 46°-Ring, Horizontalkreis, linker und rechter Supralateralbogen, linker und rechter Infralateralbogen, Parrybogen, Wegeners Gegensonnenbogen, Untersonnenbogen sowie (?) Tapes Bogen. Andere Himmelsbereiche, als auf der Zeichnung angegeben, sind durch die Bilder nicht erfaßt.
Lesenswert sind die schriftlichen Informationen der Beobachterin, die sie
mir mit den Negativen geschickt hat:
" ...Der 31. Jänner 1996 war ein strahlend schöner Tag, ca. 11.30 Uhr
vormittags, als sich eine Nebelwolke am Talboden von Osten hereinschob.
Zwischen Zell am See und Saalfelden ist im Winter meist Nebel, der aber
kaum bis zu uns hereinkommt. Mein Ferienhaus liegt zwischen Saalbach und
Hinterglemm ca. 100 m über dem Talboden auf der Sonnenseite. Zu dieser
Jahreszeit kommt kurz vor 11 Uhr die Sonne zum Haus. Ganz dünne
Nebelschwaden, deren Eiskristalle in der Sonne glitzerten, zogen unterhalb
des Hauses am Talboden dahin. Ich war auf der Terasse und sah plötzlich
(ich liebe Regenbögen) mindestens 5 Regenbögen, die einander schnitten und
im Zentrum etwa in meiner Höhe ein großes tropfenförmiges Licht..., so
grell, daß man kaum hinsehen konnte. Das Tal ist in der Höhe meines Hauses
zur gegenüberliegenden Seite max. einen halben Kilometer breit, dazwischen
spielte sich das Ganze ab und war nach wenigen Minuten (5-10 ?) wieder
verschwunden..."
Die amtliche Wetterkarte vom 31. Januar 1996 zeigte ein winterliches
Hochdruckgebiet über Polen, in dessen Einflußbereich Österreich lag und von
trockener skandinavischer Kaltluft erreicht wurde. In Saalbach (ganztägig
wolkenlos) betrug die Temperatur morgens -10,6°C, am späten Vormittag etwa
-6°C, während die luftfeuchte am Morgen bei 85%, später bei 65-70% lag.
Während beschriebener Hochdruckwetterlagen versinken Alpenvorland und
tiefer gelegene Alpentäler häufig im Nebel; darüber gibt es ungetrübten
Sonnenschein. Grenzbereiche des Nebels sind oft für Halobeobachter äußerst
ergiebig: vergl. Halos von Hermagor/Nassfeld (MM Nr. 11/1996, S. 180,
Ennstal MM Nr. 5/1997, S. 61ff) und diesmal Saalbach-Hinterglemm.
Nocheinmal recht herzlichen Glückwunsch an Frau Dipl.-Ing. Fuhrberg zu den
gelungenen Beobachtungen und danke für die Zurverfügungstellung der
Negative. Dank gilt auch Dr. Mahringer für die Übermittlung der
meteorologischen Daten und besonders Dr. Tränkle für die Simulation und die
Genehmigung ihrer Veröffentlichung, ausgesprochen in seinem vorletzten
Brief an mich.
